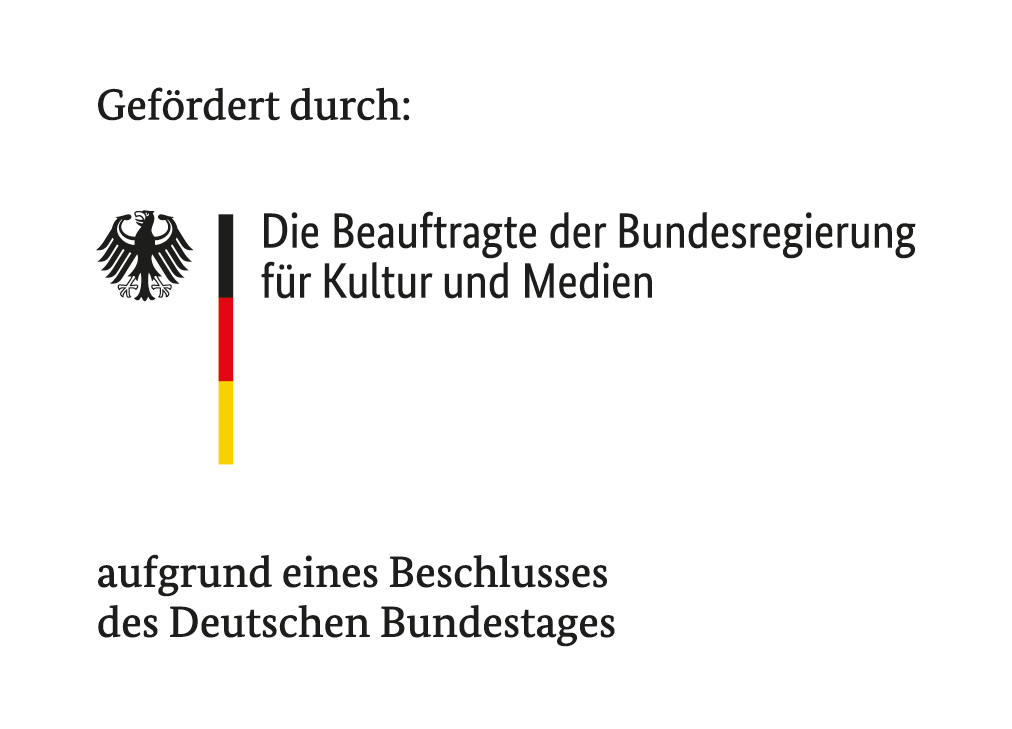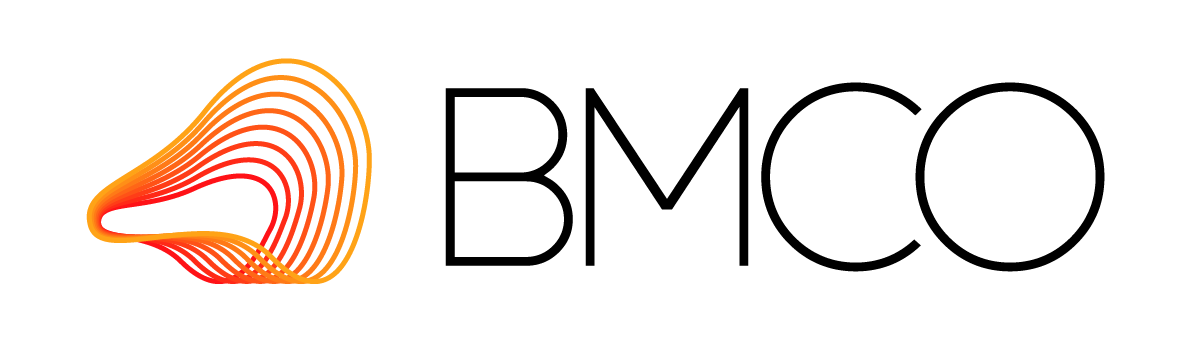Wie kann klassische Musik barrierefrei und inklusiv gestaltet werden? Dirigent Fabian Enders erklärt uns im Interview, warum Gesprächskonzerte, öffentliche Proben und Kammermusik die Türen zum Konzertsaal öffnen können – und wie Musik Menschen verbindet, selbst dort, wo Worte versagen. Ein Interview aus der Praxis.
Welche Maßnahmen halten Sie für besonders effektiv (wenn es Ihrer Ansicht nach welche gibt), um den klassischen Konzertbesuch für Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten zugänglicher zu gestalten?
Einerseits fällt einem bei der Frage der Zugänglichkeit das Überwinden von Barrieren im Wortsinne ein, wofür vielerorts Lösungen gefunden wurden und an weiteren gearbeitet wird. Andererseits denke ich daran, dass wir mit einer Art „gestaffelter Öffentlichkeit“ unserer Arbeit Menschen mit Behinderung den Zugang zur Musik erleichtern können: Oft bietet sich bei der Erarbeitung von Orchestermusik an, die letzte Stunde einer Generalprobe am Vormittag für eine geladene Gruppe zu öffnen, daraus ein Mini-Konzert mit Moderation zu machen, zugeschnitten auf die Zielgruppe, vielleicht in Form eines Gesprächskonzerts. Wenn unmittelbar zuvor noch ein kurzes Gespräch zwischen der Gruppe und der musikalischen Leitung möglich wird, wirkt sich die kurzfristig entstandene persönliche Beziehung sicher positiv aus. Besonders geeignet scheint mir hier Programmmusik, um über außermusikalische Inhalte noch leichter eine Beziehung zum Wesen eines Werks aufzubauen. So ein vormittägliches „Fast“-Konzert ist denn auch eine Lösung in Hinblick auf die Erschwinglichkeit.
Welche physischen, kommunikativen oder sozialen Barrieren sehen Sie aktuell im klassischen Musikbetrieb, die einer inklusiven Teilhabe im Publikum entgegenstehen? Ich frage hier auch, ob man den Musikern etwa Störgeräusche u. ä. zumuten kann, darf oder sollte.
Viele Konzerthäuser verfügen über einen akustisch austarierten Saalplan. Abänderungen scheinen die Logistiker gelegentlich vor unabsehbare Herausforderungen zu stellen, wobei doch das Interesse auch derjenigen Menschen, die sich sitzplatzmäßig nicht „einreihen“ können, kein Novum ist. Hinsichtlich der kommunikativen Barrieren meine ich, dass das Erwartungshaltungsmanagement für alle Seiten immer neu in den Blick genommen werden muss: Beispielsweise gibt es gesundheitliche Umstände, die bei einem Menschen zu einer sehr individuellen Wahrnehmung der verstreichenden Zeit führen können, somit zu Ungeduld, Unbehagen und Unruhe im Verlauf eines längeren Werks. Ich denke, dass allen Menschen, die keine geübten Konzertbesucher sind, die gezielte Auswahl des Repertoires für ihre ersten (oder nach langer Zeit ersten) Erfahrungen mit der Musik hilft: Wer zum Beispiel im Verstehen der gesungenen englischen Sprache kaum geübt ist, wird von einer knapp drei Stunden umfassenden Aufführung von Händels Oratorium „Samson“ vielleicht nicht sofort für den Konzertbetrieb gewonnen. Wenn man einen Liederabend anbietet, zwei agierende Personen und eine Fülle von Themen, die unser aller Leben und Innenleben stetig berühren, sinnerfüllt und farbenreich vorgetragen, mit einer Pause nach ca. 30 Minuten, so hat man beste Aussichten, Menschen voraussetzungslos in den Bann der Musik zu ziehen. Ich denke zum Beispiel an viele Lieder Mendelssohns, deren Melodien man mit nach Hause nehmen kann und lang behält. So ein Liederabend (der nicht abends stattfinden muss) ist in vielen Arten von Räumen möglich. Er kann zu den Menschen, in kleine Räume gebracht werden. Ich glaube, solche Angebote sind wichtig, um Reaktionen der Betroffenen zu erproben: Wird die Musik als Bereicherung, als Gewinn, als Trost oder vielleicht als Belastung empfunden?
Störgeräusche sind ein Thema, das uns im Konzertleben zunehmend beschäftigt. Ich denke, dass bei deren Bewertung viele Faktoren berücksichtigt werden müssen, vorrangig die richtige Ausrichtung und Deklaration einzelner Konzertformate. Geräusche werden von jedem Menschen unterschiedlich bewertet und ich werde als Dirigent wie als Konzertbesucher oft an den Grundsatz erinnert, dass die Freiheit des einen keine Beeinträchtigung der Freiheit des anderen mit sich bringen sollte: Hierbei geht es aber zumeist um einen durchaus freiwilligen Verzicht auf Empathie. Einstellen kann man sich allemal auf besondere, spontane Reaktionen, wo sie man sie zu erwarten hat.
Inwiefern können klassische Orchester durch Inklusionsprojekte als Vorbilder für andere kulturelle Einrichtungen fungieren? Wäre dies denkbar?
Ich bin, wie oben anklang, ein Freund des Prinzips Kostprobe: Die Kunstlieder Mendelssohns, die Bagatellen Beethovens, die „Waldszenen“ von Robert Schumann sind ein Fundus, aus dem so unbeschreiblich Kostbares genommen und angeboten werden kann, Miniaturen von zwei oder drei Minuten Dauer und Momente intensiven Erlebens, in dem ein oder zwei Ausführende im Wort- und geistigen Sinn nah bei den Menschen sind, dass ich diese Erfahrung zunächst einem ausgedehnten Konzertbesuch vorziehen würde und schauen, welche Verbindungen sich vom Gehörten zum Hörer erschaffen und erkennen lassen. Im Falle klassischer Orchester kann die Kammermusik der Weg sein, auf dem „mit leisen Tönen“ erste Schritte Richtung Brücke zum Sinfoniekonzert gegangen werden.
Gibt es im klassischen Repertoire oder in der Aufführungspraxis besondere Möglichkeiten, Programme inklusiv zu gestalten, sowohl für Musiker als auch für das Publikum?
Ich denke daran, dass es für die großen Liedsänger der Vergangenheit eine Selbstverständlichkeit war, sich der Volkslieder anzunehmen. Hier beispielsweise gemischte Programme zu entwickeln, bei denen erst eine Weile zugehört, dann mitgesungen werden kann, darf und soll, ist eine wunderschöne Möglichkeit der Inklusion. In meinem eigenen Leben bedeutete dies eine besondere Verbindung zu meiner Großmutter, der 21 Jahre lang die Sprache abhanden gekommen war und die nur noch wenige Worte formulieren konnte: Fing man aber ein Lied zu singen an, das ihr aus der Vergangenheit bekannt war, erwachten die Erinnerungen und mit den Melodien die Texte, die sie wunderbar mit uns singen konnte. Dies war zu einem einzigen Weg geworden, durch Sprache – und nur mittels der Musik – etwas ausdrücken zu können und bedeutete ein großes aktivierendes und kommunikatives Moment für sie – wie auch Momente großer Freude für uns in der langen Zeit ihrer Krankheit.
Ferner denke ich, dass vielleicht für manchen Menschen, dem wir Musik nahebringen wollen und dafür Barrieren überwinden müssen, eine Teilhabe am Probenprozess spannender sein könnte als ein Konzertbesuch, weil wir Musikanten da auf manchmal unterhaltsam nachvollziehbare Weise am Basteln sind und etwas zusammenwächst: Schönheit im Entstehen erleben. Manchmal ist das spannender als vorgeführte Perfektion.
Welche langfristigen strukturellen Veränderungen sind denkbar, um Inklusion und Teilhabe im professionellen klassischen Musik- und Orchesterbetrieb nachhaltig zu verankern?
Wir müssen der kleinen Form und dem kleinen Format mehr Raum und Aufmerksamkeit schenken, Lied und Kammermusik stärken. Das „Herausgehen“ aus dem Konzertsaal sollte uns Musikanten zum regelmäßigen Anliegen werden: Nehmen wir das Wort „Abholen“ doch einmal wörtlich. Chöre können mit kleinen Formationen einen ähnlichen Beitrag leisten. Ich denke zum Beispiel daran, dass im Leipzig der Bach-Zeit das sogenannte Neujahrsumsingen üblich war, wo kleine Gruppen des Thomanerchors in die Wohnhäuser der Menschen kamen, um für sie zu singen. Ich denke, dass gerade in kleineren Städten Formate wie Nachmittagskonzerte, Gesprächskonzerte oder öffentliche Teilproben mit Gesprächsanteilen stärker etabliert werden können und bei Reisen in Städte, in denen es kein eigenes Orchester gibt, vor dem abendlichen Konzert vielleicht ein gekürztes Gesprächskonzert stattfinden kann, auf das die Menschen, denen man dieses Erlebnis wünscht, vorbereitet werden.
Ganz wichtig scheint mir dabei, dass Menschen nie allgemein für „die Klassische“ Musik gewonnen werden oder verloren sind und man den Stellenwert des gut gewählten und gut vermittelten Repertoires als das Entscheidende erkennt.
Foto: fabianenders.de