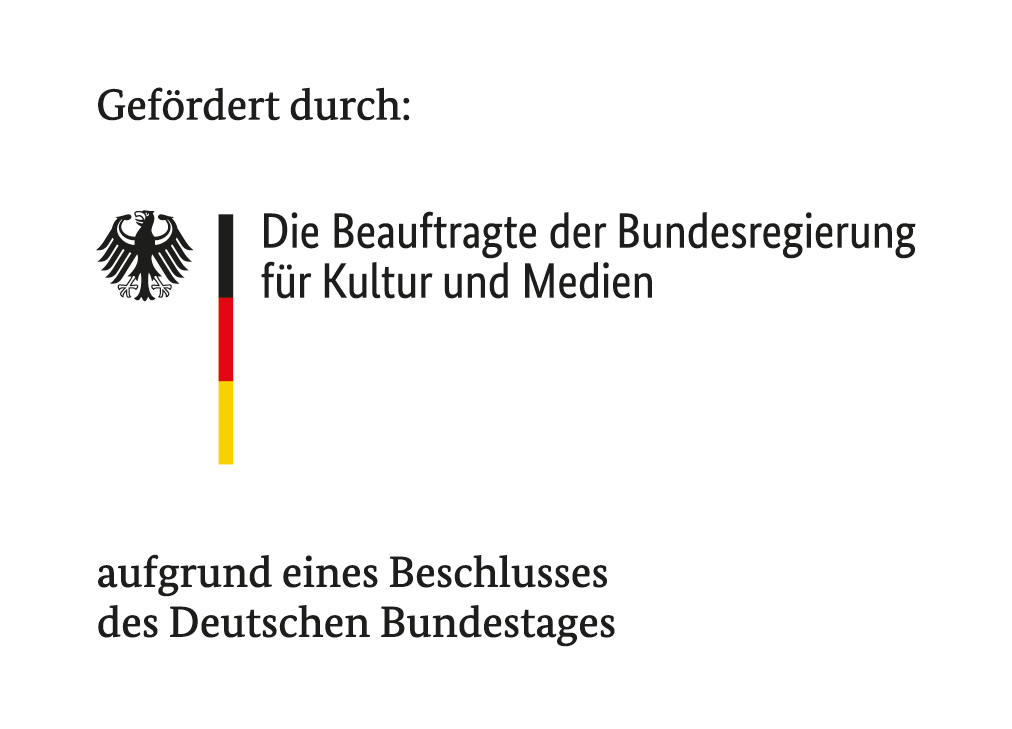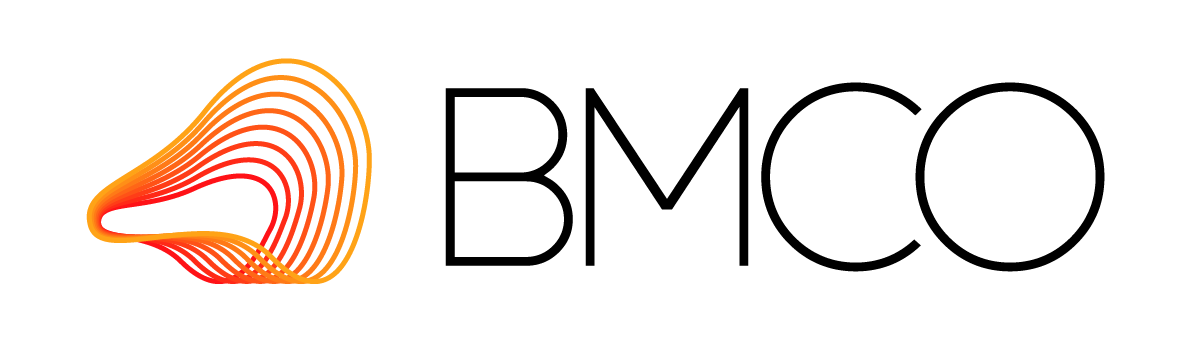Bildungsreferent Jonas Jacob erklärt, warum Inklusion seit der UN‑Behindertenrechtskonvention ein einklagbares Recht ist, welche Pflichten sich daraus für Chorträger ergeben und wie Barrierefreiheit vom Probenraum bis zur digitalen Kommunikation praktisch umgesetzt werden kann. So wird deutlich, dass Vielfalt nicht nur juristische Vorgabe, sondern auch musikalischer Gewinn ist.
Musik verbindet – niemand darf ausgeschlossen werden. Dieses Motto bringt auf den Punkt, worum es beim Thema Inklusion in der Chormusik geht: Musik sollte allen Menschen offenstehen, unabhängig von Behinderung, Herkunft oder anderen Merkmalen.
In der Realität stoßen jedoch viele auf Barrieren – sei es die Treppe ohne Rampe zum Probenraum, fehlende Noten in Brailleschrift oder Vorurteile gegenüber „ungewöhnlichen“ Chormitgliedern. Dabei ist Inklusion nicht nur ein gesellschaftliches Ideal, sondern ein verbrieftes Recht: Bereits seit 2009 gilt Inklusion in Deutschland laut UN-Behindertenrechtskonvention als Menschenrecht, das auch die Teilhabe an Freizeitaktivitäten wie dem Chorsingen umfasst.
Dieser Blogbeitrag beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Rechts auf Inklusion im musikalischen Bereich, erläutert die Verpflichtungen für Chorträger – insbesondere öffentliche – und zeigt konkret, was Barrierefreiheit in der Chorpraxis bedeutet. Außerdem betrachten wir, welche rechtlichen und gesellschaftlichen Argumente für mehr Diversität in Chören sprechen. Ziel ist es, zu motivieren und zu informieren: Die juristischen Hintergründe werden verständlich erklärt und praktische Wege zur inklusiven Chorarbeit aufgezeigt – damit am Ende alle im Chor sagen können: „Hier klingt’s mir gut.“
Rechtliche Grundlagen: Inklusion ist ein Menschenrecht
Das Recht auf Inklusion in Kunst und Kultur hat feste Anker in internationalen und nationalen Rechtsnormen. Allen voran steht die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die Deutschland 2009 ratifiziert hat. Sie stellt klar, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt Zugang zum kulturellen Leben haben müssen. Artikel 30 UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten, geeignete Maßnahmen zu treffen, damit Menschen mit Behinderungen an kulturellen Aktivitäten – vom Konzertbesuch bis zum eigenen Musizieren – ohne Barrieren teilhaben können. Konkret bedeutet das zum Beispiel: kulturelle Angebote in zugänglichen Formaten, barrierefreie Veranstaltungsorte und die Förderung der aktiven künstlerischen Betätigung von Menschen mit Behinderung. Inklusion ist damit kein „Nice-to-have“, sondern ein einklagbares Recht im Sinne der Menschenrechte.
Auch das deutsche Gleichstellungsrecht unterstreicht die Bedeutung von Inklusion. Das Grundgesetz selbst verankert in Artikel 3 Absatz 3 ein Diskriminierungsverbot: „Niemand darf wegen seines […]Behinderung benachteiligt werden.“ – und nennt explizit auch andere Merkmale wie Geschlecht, Abstammung, Sprache, Herkunft, Glaube oder politische Anschauungen. Dieser Verfassungsgrundsatz gilt zwar direkt nur für den Staat, aber er setzt einen Maßstab, an dem sich die gesamte Gesellschaft orientieren soll. Um dieses Benachteiligungsverbot mit Leben zu füllen, gibt es spezielle Gesetze: So regelt das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Bereich und verpflichtet Bundesbehörden, ihre Einrichtungen barrierefrei zu gestalten. Kein Zufall: Das BGG trat 2002 in Kraft und wurde nach Inkrafttreten der UN-BRK 2009 weiter verschärft, etwa mit Anforderungen an Leichte Sprache und digitale Barrierefreiheit in Ämtern.
Parallel dazu verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und anderer Diversitätsmerkmale (etwa ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter oder sexuelle Identität) im Arbeitsleben und bei sogenannten Massengeschäften des Alltags. Sobald also ein Chor seine Angebote öffentlich macht – sei es durch offene Mitgliederwerbung oder öffentliche Konzerte – gelten die Prinzipien des AGG: Niemand darf ausgeschlossen werden, nur weil er/sie „anders“ ist. Kurz gesagt: Inklusion ist rechtlich geboten. Es geht nicht um freiwillige Gefälligkeiten, sondern um Ansprüche, die Menschen mit Behinderung und anderen Diskriminierungsrisiken zustehen. Diese Ansprüche sind durch internationale Verträge und nationale Gesetze geschützt – und sie beziehen ausdrücklich auch den Bereich Musik und Kultur mit ein.
Verpflichtungen für Chöre – besonders mit öffentlicher Förderung
Welche Pflichten ergeben sich aus diesen Rechten nun für diejenigen, die Chöre tragen und organisieren? Zunächst gilt: Öffentliche Hände – also etwa staatliche oder kommunale Einrichtungen, die einen Chor betreiben oder finanziell fördern – unterliegen in besonderem Maße den genannten Gesetzen. Als Teil der öffentlichen Gewalt müssen sie Barrierefreiheit sicherstellen und dürfen niemanden aufgrund einer Behinderung benachteiligen. Ein konkretes Beispiel: Findet die Chorprobe in einem städtischen Kulturzentrum statt, so muss die Kommune dafür sorgen, dass der Probenraum barrierefrei zugänglich ist (Aufzüge, Rampen, barrierefreie Toiletten etc.). Baurechtliche Vorgaben schreiben heute bei Neubauten ohnehin Barrierefreiheit vor – aber auch Bestandsgebäude, die öffentlich genutzt werden, müssen nachgerüstet oder zumindest alternative Lösungen angeboten werden (z. B. Probenräume im Erdgeschoss). Fördergelder von Staat oder Ländern sind zunehmend an Auflagen geknüpft, die Inklusion und Diversität berücksichtigen.
So betonte Kulturstaatsministerin Claudia Roth 2024, dass Inklusion ein Kern der Demokratie sei und bei allen Fördermaßnahmen mitgedacht werden müsse. Öffentliche Geldgeber erwarten also von Chören und Kulturvereinen, dass sie Konzepte haben, um Teilhabe zu ermöglichen – sei es durch barrierefreie Konzerte, inklusives Marketing oder diversitätsbewusste Programmauswahl.
Doch nicht nur der Staat ist in der Pflicht. Auch private Chöre und Vereine sollten die Rechtslage nicht ignorieren. Zwar mag ein kleiner unabhängiger Chor rechtlich nicht unmittelbar an die UN-BRK gebunden sein. Aber das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz kann durchaus greifen, wenn ein Chor z. B. neue Mitglieder durch öffentliche Aushänge sucht oder Konzerte für jedermann anbietet – dann dürfen Menschen mit Behinderungen oder anderer Herkunft nicht einfach abgewiesen werden. Absagen nach dem Motto „Du passt nicht zu uns“ sind riskant, wenn dahinter eigentlich ein verbotenes Diskriminierungsmotiv steckt. Zudem haben Menschen mit Behinderung einen Anspruch auf angemessene Vorkehrungen: Das heißt, zumutbare Anpassungen müssen vorgenommen werden, um ihnen die Teilnahme zu ermöglichen. Kommt ein öffentlich geförderter Chor diesen Pflichten nicht nach, kann das Konsequenzen haben – von Fördermittelkürzungen bis hin zu Beschwerden bei Antidiskriminierungsstellen oder im Extremfall sogar gerichtlichen Auseinandersetzungen. Es sollte aber gar nicht erst so weit kommen. Wer Chöre leitet oder verwaltet, ist gut beraten, Inklusion proaktiv anzugehen – nicht nur aus Angst vor dem Gesetz, sondern weil es auch dem Chor selbst nützt. Mit anderen Worten: Inklusion schafft ein besseres Chorklima, weil alle das Gefühl haben dürfen, willkommen zu sein. Und am Ende profitiert der Chor von einer vielfältigen Gemeinschaft – gesetzeskonform und menschlich bereichernd.
Barrierefreiheit in der Chorpraxis: Was bedeutet das konkret?
Inklusion in der Chormusik beginnt mit Barrierefreiheit. Oft denkt man dabei zuerst an bauliche Aspekte, doch Barrierefreiheit umfasst weitaus mehr – nämlich auch kommunikative, digitale und soziale Zugänglichkeit. Was heißt das nun im Alltag eines Chores? Hier einige zentrale Bereiche und praktische Ansätze, wie Barrieren abgebaut werden können:
- Proben- und Auftrittsräume: Die räumliche Barrierefreiheit ist fundamental. Probenräume und Konzertsäle sollten stufenlos erreichbar sein – idealerweise per Rampe oder Aufzug. Breite Türen, genügend Platz für Rollstühle oder Rollatoren und nahegelegene barrierefreie WCs sind ein Muss. Auch an Kleinigkeiten denken: reservierte Parkplätze in Eingangsnähe, Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen vor dem Einsingen und ggf. Rückzugsräume für Personen, denen Trubel schnell zu viel wird. Falls ein Auftritt auf einer Bühne stattfindet, braucht es einen Zugang (Rampe oder Hebebühne) für mobilitätseingeschränkte Sänger/innen. Diese Maßnahmen werden leider noch oft übersehen, sind aber grundlegend, damit alle teilnehmen können.
- Notenmaterial und Kommunikation: Barrierefreiheit umfasst auch die Informationsvermittlung. Ein Chor sollte prüfen, ob Noten und Texte für alle lesbar sind. Für Sehbehinderte kann das heißen: Noten in großer Schrift oder in Brailleschrift bereitstellen. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Lernschwierigkeiten hilft es, wenn Liedtexte in Einfacher Sprache vorliegen und komplexe musikalische Fachbegriffe vermieden oder erklärt werden. Möglich ist auch, Notenblätter durch piktografische Darstellungen zu ergänzen – z. B. Gebärdenbilder oder Symbole, die den Text illustrieren. So ein visueller Zugang kann gerade in inklusiven Gruppen helfen, den Inhalt eines Liedes zu vermitteln. Für gehörlose oder schwerhörige Chormitglieder sind Technische Hilfsmittel entscheidend: Etwa Induktionsschleifen oder FM-Anlagen, die das Chorleiterin-Direktionssignal direkt auf Hörgeräte übertragen. Auch taktiles Dirigieren (z.B. leichte Berührungen im Takt) oder das Visualisieren von Einsätzen mit Lichtern könnten kreative Lösungen sein. Wichtig ist, dass Kommunikationsbarrieren abgebaut werden – jeder soll die Probeinhalte mitbekommen können, egal ob durch Hören, Sehen oder Fühlen.
- Sprache und Probenmethodik: Eine inklusive Chorleitung achtet auf verständliche, inklusive Kommunikation. Das beginnt bei der Sprache: Komplizierte verschachtelte Sätze oder Fachchinesisch erschweren manchen die Teilnahme. Besser ist es, in der Probe möglichst klar und direkt zu sprechen, Fremdwörter zu erklären, in Aktivform zu formulieren und bekannte Begriffe konsistent zu verwenden. Viele Chorleiterinnen inklusiver Gruppen empfehlen den Einsatz des „Zwei-Sinne-Prinzips“: Also Informationen gleichzeitig visuell und auditiv zu vermitteln. Konkret könnte die Chorleitung ein musikalisches Motiv vorsingen (hören) und zugleich auf einem Plakat oder Whiteboard den Einsatzpunkt markieren oder Bilder zur Stimmung des Stücks zeigen (sehen). So können die Chormitglieder auf verschiedenen Kanälen aufnehmen, was gemeint ist. Übungsaufnahmen (Audio oder Video) zum Nachhören für zuhause sind eine weitere Hilfe – sie unterstützen nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern eigentlich alle Sängerinnen beim selbstständigen Proben. Generell gilt: Offen für individuelle Bedürfnisse sein. Wer zum Beispiel aufgrund einer Behinderung Pausen braucht oder bestimmte Aufgaben nicht übernehmen kann (z. B. schweres Notenpult tragen), sollte ohne Aufhebens entlastet werden. Hier ist Flexibilität gefragt – und die kostet oft nichts außer ein wenig guten Willen.
- Digitale Teilhabe: Unsere Chöre kommunizieren längst digital – per E-Mail, WhatsApp-Gruppe, über Websites oder soziale Medien. Auch hier lauern Barrieren, die es abzubauen gilt. Eine Chor-Website etwa sollte barrierefrei gestaltet sein, d.h. sie sollte mit Screenreadern navigierbar sein, Bilder mit Alternativtext versehen und Videos untertitelt oder in Gebärdensprache übersetzt anbieten (insbesondere wenn dort Konzertmitschnitte oder Chor-News geteilt werden). Für öffentlich finanzierte Einrichtungen ist dies ohnehin Pflicht (Stichwort: Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung), aber auch jeder Vereins-Chor kann mit wenig Aufwand seine Online-Präsenz zugänglich machen. Digitale Teilhabe heißt auch: Überlegt, ob Online-Proben oder Hybridformate möglich sind, falls z.B. ein Chormitglied wegen chronischer Krankheit nicht immer vor Ort sein kann. In Zeiten von Videokonferenzen könnte man einzelne Stimmproben online durchführen oder zumindest wichtige Infos per Video teilen – natürlich mit Untertiteln. Diese Technologien können Brücken bauen, sollten aber immer nur ergänzen, nicht ersetzen, was das gemeinsame Singen vor Ort ausmacht.
- Sensibilisierung und Unterstützung: Barrierefreiheit besteht nicht nur aus Technik und Infrastruktur – entscheidend ist die geistige Barrierefreiheit. Damit ist die Haltung aller Beteiligten gemeint. Ein Chor, der inklusiv sein möchte, tut gut daran, sein Team vorzubereiten: Schulungen oder Workshops können viel bewirken, um Berührungsängste abzubauen. Wenn die Chormitglieder verstehen, welche Bedürfnisse ihre Kollegen mitbringen (sei es die blinde Altistin, der autistische Tenor oder der Rollstuhlfahrer im Bass), lassen sich viele Unsicherheiten ausräumen. Eine offene Austauschkultur gehört dazu: Lieber direkt fragen, welche Unterstützung jemand braucht, als stillschweigend zu rätseln. Wichtig ist, eine Atmosphäre der Achtsamkeit zu schaffen, in der Fehler okay sind und man gemeinsam lernt. Niemand erwartet Perfektion – aber Offenheit. Inklusion bedeutet, zusammen nach Lösungen zu suchen und ggf. externe Hilfe einzubeziehen. Chorverbände, Inklusionsbeauftragte oder Projekte wie „Hier klingt’s mir gut“ bieten Beratung und Coaching an, damit kein Ensemble diese Aufgabe allein stemmen muss.
Wie man sieht, sind viele der genannten Maßnahmen kein Hexenwerk. Oft sind es kleine, wirkungsvolle Schritte, die einen Chor barriereärmer machen – sei es der Einbau einer Rampe oder die Anschaffung einiger Noten in Blindenschrift. Anfangs mögen die rechtlichen Vorgaben und praktischen To-Dos nach viel klingen. Doch Schritt für Schritt lassen sich Hürden überwinden. Wichtig ist, dass Inklusion zur selbstverständlichen Routine wird: Wenn jede Konzertplanung automatisch die Punkte „Ist der Saal barrierefrei?“ und „Haben wir an alle besonderen Bedarfe gedacht?“ abklopft, ist schon viel gewonnen. Und: Man muss das Rad nicht allein neu erfinden. Der Austausch mit anderen inklusiven Projekten (z.B. über Best-Practice-Foren) und die Nutzung von vorhandenen Ressourcen (Ratgeber, Checklisten, Beratungsangebote) erleichtern den Weg enorm.
Vielfalt im Chor: Rechtliche und gesellschaftliche Argumente für Diversität
Inklusion beschränkt sich nicht auf die Dimension Behinderung. Diversität im Chor bedeutet, alle Unterschiede wertzuschätzen – sei es Herkunft, Kultur, Religion, Alter, Geschlecht oder sexuelle Identität. Rechtlich untermauert ist auch dies: Wie oben erwähnt, schützt Artikel 3 GG Menschen vor Benachteiligung z.B. wegen ihrer Abstammung, Sprache, Heimat, Glaubensrichtung oder des Geschlechts. Das heißt, staatliche Stellen (und im erweiterten Sinne alle öffentlich geförderten Chöre) dürfen niemanden aufgrund solcher Merkmale ausschließen. Ein städtischer Chor könnte sich also nicht „legal“ weigern, jemanden aufzunehmen, nur weil die Person eine bestimmte Ethnie oder Religion hat – das wäre klar grundgesetzwidrig. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene sorgt das AGG dafür, dass z.B. bei der Aufnahme in Vereine oder beim Zugang zu Veranstaltungen niemand aufgrund von Rassismus, Sexismus etc. diskriminiert werden darf. Kurz gesagt: Diversität zuzulassen ist kein Gnadenakt, sondern entspricht dem Gleichbehandlungsgebot unserer Rechtsordnung.
Neben diesen juristischen Aspekten sprechen viele gesellschaftliche und künstlerische Gründe für mehr Vielfalt in Chören. Musik war schon immer eine Brücke zwischen Menschen verschiedener Hintergründe. In den letzten Jahren ist das Bewusstsein dafür stark gewachsen. So hat die Deutsche Chorjugend unter dem Hashtag #chorliebestatthass ein Zeichen für kulturelle und religiöse Vielfalt, Inklusion, Gleichberechtigung und Antidiskriminierung in der Chorszene gesetzt. Viele Chöre – ob in den USA oder in Deutschland – haben begonnen, Antidiskriminierungs-Statements in ihre Statuten aufzunehmen. Das ist nicht bloß politische Rhetorik – es erleichtert auch ganz praktisch den Zugang für bisher unterrepräsentierte Gruppen. Ein Chor, der offen sagt „Wir heißen alle willkommen“, senkt für viele die Hemmschwelle, überhaupt zur Probe zu kommen.
Vielfalt im Chor ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Künstlerisch eröffnen sich neue Horizonte: Unterschiedliche kulturelle Hintergründe der Mitglieder können das Repertoire bereichern – plötzlich stehen Lieder in vielen Sprachen auf dem Programm, vom afrikanischen Gospel bis zum lateinamerikanischen Volkslied, was den musikalischen Horizont erweitert. Auch innerhalb der westlichen Chormusik gibt es „blinde Flecken“, die durch diverse Perspektiven aufgedeckt werden können (etwa Werke von Komponistinnen oder von Minderheiten, die bisher wenig beachtet wurden). Sozial fördert ein bunter Chor den Zusammenhalt und das Verständnis. Wenn Menschen verschiedenster Lebenswelten zusammen singen, lernen sie einander auf Augenhöhe kennen. Vorurteile, die man gegenüber Fremden hat, schwinden, wenn aus dem „Fremden“ ein Chorkollege wird. Chorleiter Ralf Schuband etwa berichtet, wie er einen Männerchor, einen gemischten Chor, einen Werkstattchor für Menschen mit Behinderung und einen Chor der offenen Behindertenhilfe für gemeinsame Auftritte zusammengebracht hat – zunächst hatten alle ein wenig Berührungsängste, doch dann „haben die Mitglieder der verschiedenen Chöre untereinander viel gelernt und sind sich nähergekommen, bis man wusste, wie der andere tickt“. Ein besseres Argument für gelebte Vielfalt kann man kaum finden: Es entsteht Gemeinsamkeit in der Einzigartigkeit eines jeden.
Zudem entsprechen vielfältige Chöre einfach der Realität: Unsere Gesellschaft ist divers, also sollten es unsere Kulturangebote auch sein. Öffentliche Förderer betonen immer häufiger, dass eine inklusive und diverse Kulturlandschaft ein Gewinn für die Demokratie ist. Denn Kultur spiegelt, wer an ihr teilhat. „Inklusion ist ein Kerngedanke der Demokratie“, so Claudia Roth, „denn Demokratie gelingt nur, wenn möglichst alle an ihr mitwirken. Das gilt in besonderem Maße auch für die Kultur.“. Ein Chor, in dem alle Stimmen gehört werden, wird damit zum kleinen Mikrokosmos einer demokratischen, offenen Gesellschaft.
Nicht zuletzt hat Diversität auch einen starken individuellen Wert: Für die einzelnen Sänger*innen bedeutet es viel, sie selbst sein zu dürfen im Chor. Wer etwa queer ist, muss keine Angst haben, im Kirchenchor Ausgrenzung zu erfahren – oder jemand mit Migrationsgeschichte darf erleben, dass sein Liedgut auch Platz findet. Diese Wertschätzung stärkt das Selbstbewusstsein und die Bindung ans Ensemble. Und sie gibt dem Publikum ein wichtiges Signal: Hier auf der Bühne steht ein Abbild der Vielfalt unserer Welt, vereint in der Musik. Das empfanden schon viele als bewegend und ermutigend.
Schließlich sprechen auch ethische Argumente für Vielfalt: Gerechtigkeit und Gleichberechtigung dürfen im Kulturbereich nicht haltmachen. Teilhabe an Kunst und Kultur ist laut verschiedenen Menschenrechtsdokumenten ein Menschenrecht für jeden – unabhängig von Talent oder Besonderheit. „Die kulturelle Teilhabe, aber vor allem auch die Teilgabe von Talenten ist ein Menschenrecht – und eine Bereicherung für uns als Gesamtgesellschaft“, bringt es der Dirigent und Inklusions-Aktivist Benedikt Lika auf den Punkt. Jeder Mensch hat etwas einzubringen. Ein Chor, der mehr Menschen die Chance gibt mitzumachen, schöpft aus einem größeren Pool an Talent, Ideen und Geschichten. Das kommt am Ende dem Klang und der Ausdruckskraft des Chores zugute – und es bereichert unsere gesamte Gesellschaft, wenn Musik von allen mitgestaltet wird.
Fazit: Inklusive Chorarbeit – gemeinsam Schritte in die richtige Richtung
Inklusion und Diversität in der Chormusik sind kein Luxus, sondern eine Frage der Menschenwürde und Kreativität. Rechtlich ist die Sache eindeutig: Niemand darf ausgeschlossen werden, und alle haben das Recht, an Musik teilzuhaben – ob als Zuhörende oder Aktive.
Natürlich gibt es auch Hürden. Einige sind praktischer Natur (bauliche Veränderungen, Finanzierung von Hilfsmitteln), andere im Kopf (Unsicherheiten, mangelnde Erfahrung). Doch keine dieser Hürden ist unüberwindbar – vor allem nicht, wenn man sich Unterstützung holt. Immer mehr Initiativen und Netzwerke befassen sich mit Inklusion in der Kultur. So bietet zum Beispiel das Projekt „Hier klingt’s mir gut“ Beratung, Workshops und sogar Auszeichnungen (Prädikate) für Chöre, die Teilhabe aktiv leben. Solche Angebote kann man nutzen, um den eigenen Chor auf den Weg zu bringen. Auch Chorverbände oder Behindertenbeauftragte (kommunal oder auf Landesebene) helfen oft mit Tipps und Förderhinweisen weiter. Die rechtlichen Vorgaben sind dabei kein Hindernis, sondern ein Rückhalt: Sie geben euch das Argumentationswerkzeug in die Hand, um etwa bei der Stadt Mittel für eine Rampe lockerzumachen oder innerhalb des Vereins Überzeugungsarbeit zu leisten, warum inklusive Maßnahmen sein müssen.
Am Ende lohnt sich der Einsatz für Inklusion und Vielfalt in jedem Fall. Musik lebt von Vielfalt – jede Stimme zählt, und je bunter der Chor, desto voller der Klang. Ein inklusiver Chor ist mehr als die Summe seiner Teile: Er kann zu einem Ort der Begegnung werden, an dem Menschen sich öffnen und voneinander lernen. Wenn niemand ausgeschlossen wird, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das auch musikalisch spürbar ist. Und die Freude, gemeinsam Hürden überwunden zu haben, schwingt in jedem Ton mit.
Fassen wir zusammen: Das Recht auf Inklusion in der Chormusik ist in Gesetzen fest verankert und spiegelt einen gesellschaftlichen Wertewandel hin zu mehr Teilhabe und Gerechtigkeit. Chöre – insbesondere öffentlich geförderte – haben die Pflicht, Barrieren abzubauen und Vielfalt zu ermöglichen. Doch viel wichtiger ist: Sie haben auch die Chance, dadurch zu wachsen und zu blühen. Inklusive Chorarbeit mag anfänglich herausfordernd sein, doch sie führt zu reicheren musikalischen Erlebnissen und menschlichen Begegnungen. Lassen wir also unseren Chören den Satz zur Maxime werden: „Lasst uns darauf achten, dass niemand ausgeschlossen wird!“ – im Probenraum, auf der Bühne und in unseren Herzen. Denn ein Chor, in dem es allen gut klingt, der klingt am allerbesten.